Boris Billaud
Inhaltsverzeichnis
- Kunstmuseum Zürich
- Oedipe und Arouet
- Neue Kunsthalle Zürich
- Neue Kunsthalle Bern
- Palazzo Wyler
- Reittiere aus Anlage

Allen gerecht zu werden, ist in einem kleinen Ökosystem schwierig, wie im Val Müstair erlebbar wird. Der Wind weht immer nur aus einer Richtung und für alle gleich.
www.kunstmuseumzuerich.ch
In den beiden aktuellen Leitbildern der Stadt Zürich sind Förderkriterien aufgeführt, die die Bildenden Kunst nur noch über drei Äste des einst vielarmigen Spektrums unterstützt. Einerseits jenes morbide Kunstangebot, dass sich mit dem Kunsthaus an die internationalen Kunsttouristen mit dem immer gleichen Programm richtet, oder andererseits, die Kunsthalle, deren Programm aus dem Jekami einer globalisierten Kunstszene besteht. Der dritte Fokus setzt auf die jüngste Generation von Künstlern, die durch die Zürcher Hochschule der Künste sozialisiert sind, während die Autodidakten (oder F+F Abgänger) dieser Generation in der Shedhalle Einzug halten dürfen.
Für das restliche semiprofessionelle Kunstschaffen bleibt nichts mehr übrig, oder nur schön formulierte Absichtserklärungen, die aus dem Lehrbuch für Führungskräfte des 21. Jahrhundert stammen: Nenne das Problem offen. Damit zeigen wir die Bereitschaft zur Anteilnahme. Das verbessert die Verhandlunsgposition und führt zu einem Zeitgewinn. Mit der Zeit lässt die öffentliche und politische Aufmerksamkeit nach oder ein anderes Problem ändert die Blickrichtung. Kulturförderpolitik sollte eine andere Welt repräsentieren oder erahnen lassen als die graue Realität. Das fordert sie schliesslich auch von der Kunst.
Oedipe und Arouet (Marie-Francois)
Installation am Zaun Bereits bei der Ankündigung war der Anbau des Kunsthauses umstritten. Nicht nur die zusätzlich gebundenen Betriebskosten beim bereits knappen Kulturbudget, sondern auch wegen inhaltlichen und museologischen Bedenken hinsichtlich Strategie und Kooperationen mit den Sammlungen zweifelhafter Herkunft (und auch der Qualität in der Breite, was bisher niemand beachtet hat). Die politischen Entscheidungsträger und die Stadtpräsidentin — die Kultur Stadt Zürich hat zu dem Thema keine Befugnisse — stellten sich taub gegenüber fachlich arrivierteren KritikerInnen. Die der Möglichkeit einer künstlerische Intervention zum Thema ergab sich durch die Bauwände, die das Gelände umzäunten, die von der Verwaltung zu diesem Zweck auch freigegeben wurden. Thematisch spielt die Aktion auf Sophokles und Voltaire und dad Thema Inzenstös und Selbsterkenntnis, resp. auf die Reue des Protagonisten, die eintritt. Das Stück sollte sich mit der Realität verbinden und so an Dynamik gewinnen. Leider hat das Ausmass der Ignoranz der Instanzen gegenüber den Verhältnissen in der Realität die Kunst und Komiker sprachlos hinterlassen.
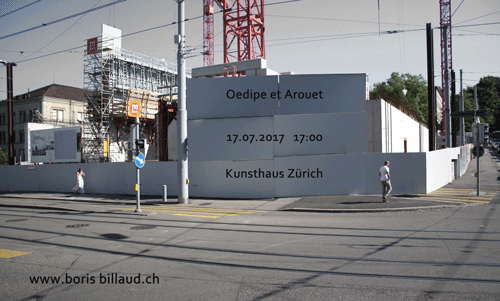
Kuratiert von Cedric Mineur
Neue Kunsthalle Zürich
Pfingstweidstrasse
Die Neue Kunsthalle Zürich reflektiert die Institution Kunsthalle. Die Kunsthallen haben ihr Gesicht in den letzten Dekaden stark verändert. Es sind zähe Dekaden der endlosen Debatten und Manifeste der späten Postmoderne und beginnenden 21. JH, die immer seltener echte Inovationen in die Provinzen brachte, je mehr ihr die Realität spätestens nach dem 9.11. die relevanten Themen entzog. Auch sie verlor den Blick auf das Ganze und das Lokale, obwohl die Anzeichen einer Krise deutlich zu sehen waren. Lieber fokussierte sie auf eine überholte Avandtgarde, liebäugelte mit Kunstmarktartikeln und setzte auf die kommende undefinierte Jugend. Und wie die Museen, taten sie es aus reinem Machtkalkühl. Halbtote Narzisten und die Jugend lassen sich am Besten manipulieren. Hochpreisiges verspricht immer an Renomée, wie es das kleinstädtische Personal sucht.


Stellungsnahme Kulturleitbild Zürich 2020
Zusammenfassung NKZ 2015-2017 (Pfingstweid)
Galerie_archiv.html

Oben: Paul Sieber (Mitte) an der Eröffnung der Kunsthalle Zürich 2015
Palazzo NREB
2013 - 2015Kunstproduktionszentrum. Das Palazzo Nreb beinhaltet die 2000m2 grosse Räumlichkeiten inklusive einer Lanstwagengarage udn deren Zufahrt im Industriequartier Bern West. Neben künstlerischen Veranstaltungen gab es drei Kunstateliers, ein Proberaum und Lagerfläche für Kunst von verschiedenen bernischen KünstlerInnen.
Mit Renée Magaña, Alexander Egger u. a.
Neue Kunsthalle Bern
Hintergrund war der Wechsel in der Direktion der Kunsthalle Bern. Erneut wurde als Leiter ein Vertreter einer jüngeren internationalen
Kuratorengilde gewählt, der als Kurator das Gebäude dazu nutzte sein persönliches Programm vorzustellen
und damit vor allem für seine Sache Werbung zu machen. Das Projekt Neue Kunsthalle Bern hat versucht die mangelnde Verknüpfung
mit dem lokalen Kunstschaffen einerseits als verpasste Chance für beide Seiten in Erinnerung zu rufen und andererseits, als konträr
zu der kritischen Theorie, die bereits seit den 70igern darauf hinweist, dass qualitative Kunst nur dort entsteht, wo sich die
unterschiedlichen Kräfte untereinander messen und förden können.
Das Projekt durchlief mehrere Etappen. Anfänglich örtlich im Palazzo Nreb in Bern West sesshaft und als eine
für jedermann jederzeit zugängliche Institution angekündigt.
Durch die Pressearbeit, die eine Ernsthaftigkeit suggerierte, entstanden u. a. im ansonsten nicht kunstaffinen Bern West überraschende Kontakte.
In der 2. Phase verwandelte
sich die Neue Kunsthalle in eine mobile Skulptur, die an Austellungen Werbung in eigener Sache machte. Als ein Jahr danach
die Skulptur "Neue Kunsthalle Bern" in der Kunsthalle Bern im Hauptraum gezeigt wurde, läutete das auch ihr Ende ein. Nach einem letzten
Auftritt als Nachtschymäre in der Sammlung Oberholzer zu Bern endete das Projekt NKB.
Epilog: Letztlich kann ein Vergleich mit der heutigen Klimadepatte gezogen werden,
auch dort wurde ein früh erkanntes Problem von Establishment ignoriert, auch aus schlichtem Opportunismus gegenüber
dem (Kunst-)Markt und seiner eigenen Gesellschaftsschicht. Dadurch, dass die Neue Kunsthalle Bern eine gewisse Zeit lang
als ernsthaftes Projekt von Kunstsammlern in der Presse publiziert war, zeigte sich, wie wichtig die öffentliche Wahrnehmmung
einer Kunstinstitutionen ist. Es zeigte einem erweiterten Publikum, dass zwischen Schein und Realität — lange vor der Hochblüte der Sozialen Medien —
nur ein paar Klicks sind udn das Zeitungen auch schon damals zuwenig fachkundiges Personal im Feuilleton hatten. Es zeigte aber auch auf, wie wenig die Öffentliche Meinung Interesse an den Institutionen zeigt, geschweige dann davon, ob
ihre Organisation und Ziele mit dem Zweck übereinstimmen.
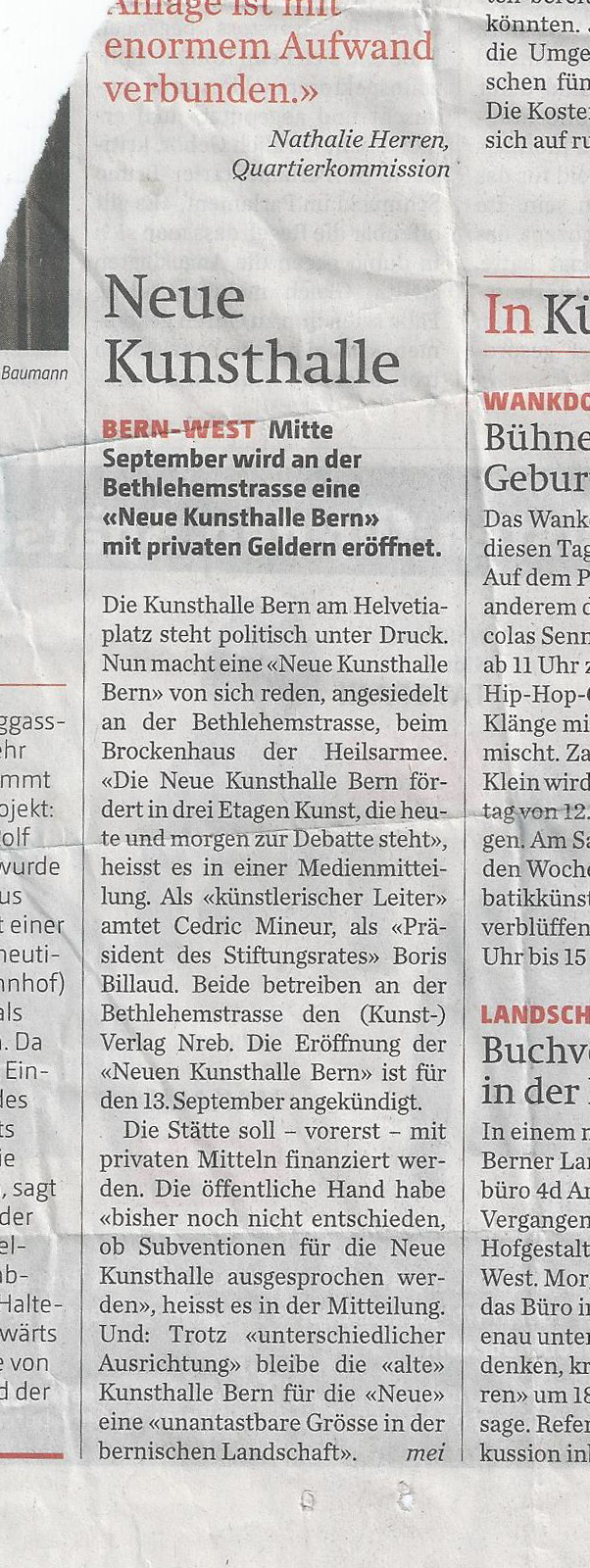
Meldung II.
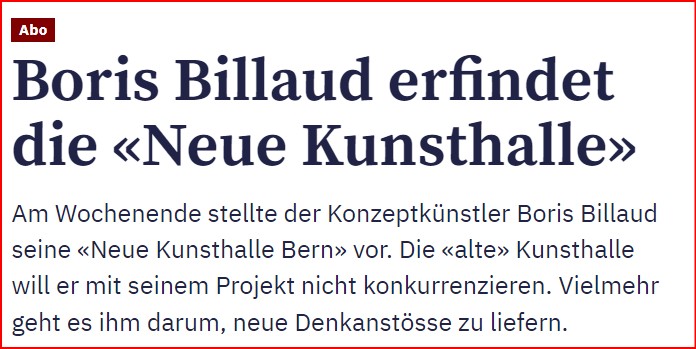
Berner Zeitung
Palazzo Wyler
Offene Bühne für zig Kunstschaffende in einem Mehrfamilienhaus. Möglich gemacht durch die Kooperation der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Bern und der hohen Toleranz der Anwohner gegenüber der 4-wöchigen Veränderung des Tagesablauf im Quartier.
Berner Zeitung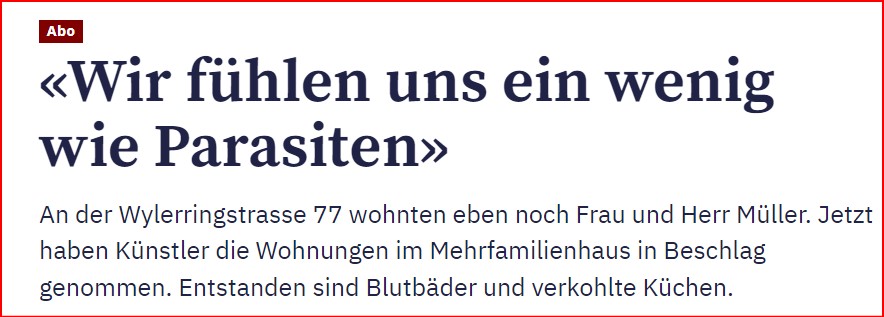
Tages Anzeiger

Reittiere aus Anlage
Gruppenausstellung mit 13 KunstschaffendenDas Ausstellungsprojekt Reittiere aus Anlage entstand aus der Unzufriedenheit einiger Berner Kunstschaffenden gegenüber der damaligen Förderpraxis zeitgenössischer Kunst des Direktors der Kunsthalle Ulrich Look und des Kunstmuseums Toni Stoos. Man warf Ihnen Voreingenommenheit vor bei der Auswahl der Kunstschaffenden für dei lokalen Ausstellungsgefässe. Vorab eine jüngere Generation von Audidakten sowie Studenten und Absolventen aus der noch frisch gegründeten Kunsthochschule beklagten die veralteten Kriterien und kritisierten den bestehenden Filz aus altvorderen KünstlerInnen und der GSMBA, die bei der Auswahl der PreisträgerInnen eine gewichtige Mitsprache hatten.
Konzeptuell war die Ausstellung darauf ausgelegt den Ausstellungsprozess von Idee bis Realisierung umzudrehen. Die Kontrolle sollten die KünstlerInnen behalten. Der oder die Künstlerin sollte bestimmen welches Werk wie ausgestellt wird. Der Kurator übernimmt im Prinzip nur die administrative Arbeit, Logistik und Foundraising, moderiert Podien, lädt Kunsthistoriker zum Einordnen der Arbeiten ein.
Epilog: Ein offener und basisdemokratischer Prozess hat immer Konfliktpotential. Anstelle dass der Kurator sein Ego durchsetzt, versuchen sich KünstlerInnen als Egomanen. Das muss der Sache nicht schaden, weil die persönlichen Positionen der Künstler — atmosphärische Hängung oder sachliche Kommunikation — so zuerst geklärt werden müssen und nicht an einen Kurator delegiert werden können. Die Position des Kurators ist dennoch im Rückblick unbestritten nötig bis sehr nützlich. Radikalität in einer solchen kurzen Zeitspanne umzusetzen, bedingt ein effizientes Vorgehen und die ästhetische Verdichtung auf ein Ziel hin, das nicht immer ins Detail kommuniziert werden kann. Ansonsten entsteht aus der Ausstellung dann selten ein Mehrwert, als die schiere Anneinanderreihung von Werken ähnlicher Qualität, wie sie auch ein unambitionierter Kurator hinkriegt. Gruppen senken das Niveau kontinuierlich, weil sie immer Kompromisse schliessen müssen, auch wenn Einzelne sicher davon profitieren. Deshalb ist eine Skepsis gegenüber dem Trend zu Co-Kuratoren und Co-KünsterInnen angebracht. Im Einzelnen kann das passen, systemisch installiert sollte es vermeiden werden
mehr
Berner Zeitung